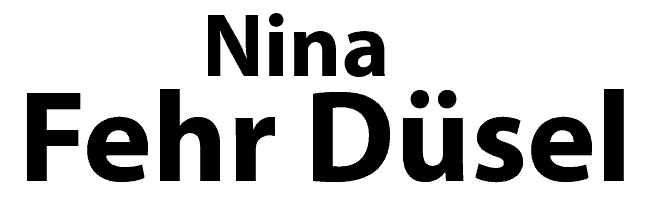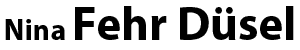Der Direktor der Strafanstalt Pöschwies findet, jeder habe eine zweite Chance verdient – vier Geschichten über das Strafen und die Resozialisierung.
Der Schweizer Justizvollzug folgt einem Ideal. Es ist das Ideal der Resozialisierung: Kriminelle kommen hinter Gitter, sühnen im Gefängnis ihre Tat und werden am Ende geläutert von der Gesellschaft wieder aufgenommen.
In den Schweizer Gefängnissen sitzen derzeit 6300 Häftlinge. Fast alle von ihnen, 99 Prozent, werden irgendwann wieder auf freien Fuss kommen. Diese 99 Prozent soll der Strafvollzug im Gefängnis auf den richtigen Weg bringen.
Aber lassen sich Männer und Frauen, die verletzt, gemordet oder vergewaltigt haben, eingesperrt hinter Gefängnismauern zu besseren Menschen machen? Wer nach Antworten auf diese Fragen sucht, muss dorthin gehen, wo Theorie und Wirklichkeit des Strafvollzugs aufeinanderprallen – in die Pöschwies im zürcherischen Regensdorf, die grösste Justizvollzugsanstalt des Landes.
Zum Direktor, der das System von innen kennt, zu einem Betreuer, der die Dramen der Häftlinge erlebt, zu einem Sexualstraftäter, an dem die Ungewissheit nagt, und zu einem Gewalttäter kurz vor der Entlassung.
Der Direktor
Andreas Naegeli kennt das System wie kaum ein anderer. Er ist der Direktor der JVA Pöschwies. In Naegelis Anstalt sitzen rund 400 Gefangene ihre Strafe ab. Unter ihnen befinden sich die gefährlichsten Straftäter des Landes. Zelle an Zelle leben Sexualstraftäter, Mörder, Messerstecher, Einbrecher und Drogenhändler. 70 Prozent sind Ausländer, die meisten von ihnen stammen aus Algerien, Kosovo oder der Türkei.
Naegeli, 59 Jahre alt, studierter Agronom, forensischer Psychologe und Offizier in der Armee, ist schon lange dabei. Seit über 24 Jahren arbeitet er im Strafvollzug, 2013 übernahm er die Leitung der Pöschwies, gut 300 Mitarbeiter sind ihm unterstellt. Für Naegeli ist es mehr als ein Job. Der «Weltwoche» sagte er einmal: «Das hier ist mein Haus. Die Pöschwies gehört dem Kanton, aber es ist meine Anstalt.» Er sagt aber auch: «Eigentlich ist unser System verrückt. Aber es ist das einzige, das wir haben. Damit müssen wir zurechtkommen.»
Viele der Insassen in der Pöschwies kommen aus schwierigen sozialen Verhältnissen, ihnen fehlt ein Schulabschluss, sie leiden an psychischen Erkrankungen, haben Suchtprobleme oder eine kurze Zündschnur. «Es sind oft Menschen mit Schwierigkeiten», sagt Naegeli. Unter diesen Bedingungen müssen seine Mitarbeiter sie auf die Freiheit vorbereiten. Indem den Häftlingen ein geregelter Alltag, eine Arbeit, Therapien und manchmal auch eine Ausbildung angeboten werden.
Naegeli sagt: «Jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber wir können uns noch so sehr bemühen – wenn einer nicht mitmachen will, misslingt die Wiedereingliederung.» Zentral ist eine Frage: Wie bringt man Straftätern bei, dass es sich lohnt, straffrei zu bleiben? «Es gibt Gefangene, die zu mir kommen und sagen: Warum soll ich mich um ein normales Leben bemühen und um einen Job, bei dem ich 3500 Franken monatlich verdiene, wenn ich früher so viel Geld in einer einzigen Nacht umgesetzt habe?»
Eine einfache Antwort darauf hat Naegeli nicht. Denn in der Freiheit wartet nicht selten die soziale Ächtung – von der Familie, im Freundeskreis, von potenziellen Arbeitgebern. Auf ehemalige Straftäter wartet die Gesellschaft nicht. Naegeli sagt: «Würde ich wollen, dass ein Vergewaltiger in die Wohnung nebenan einzieht?»
Tatsächlich gibt es bei der Wiedereingliederung immer wieder Rückschläge. Im Januar hat die Kantonspolizei einen Pöschwies-Insassen wegen des Verdachts auf den Handel mit Betäubungsmitteln verhaftet. Er verbüsste eine mehrjährige Freiheitsstrafe und befand sich seit mehreren Monaten im Wohn- und Arbeitsexternat. Das heisst, er wohnte und arbeitete ausserhalb des Gefängnisses, befand sich aber noch im Strafvollzug. In wenigen Wochen hätte er die Strafe ganz verbüsst gehabt.
Nach seiner Festnahme wurde er in Untersuchungshaft gesetzt. Sollte sich der Verdacht erhärten, würde die Freiheit wieder in die Ferne rücken.
Vor einigen Monaten war ein Gefangener, der sich ebenfalls im offenen Vollzug befand, in eine Schlägerei verwickelt. Derzeit untersucht die Staatsanwaltschaft den Fall.
Es sind die Rückfälligen, die Drehtürklienten. Straftäter, die immer wieder ins Gefängnis kommen, dort ihre Strafe absitzen und nach der Freilassung erneut delinquieren. Für sie ist das Gefängnis längst keine Abschreckung mehr. Naegeli sagt, man müsse in einem Gefängnis immer an den schlimmsten Fall denken. Für ihn ist das der Fall Zollikerberg.
Die Ursünde
Der Mord in Zollikerberg – er ist so etwas wie die Ursünde des Strafvollzugs in der Schweiz. Es geschieht am 30. Oktober 1993, der verurteilte Straftäter Erich Hauert lauert der 20-jährigen Pfadiführerin Pasquale Brumann in einem Waldstück in Zollikerberg auf, missbraucht und tötet sie. Der Mord verändert die Schweiz und den Umgang mit Straftätern wie kein anderer. Weil die Tat niemals hätte passieren dürfen.
Hauert war acht Jahre zuvor wegen zweifachen Mordes, zehn Vergewaltigungen und mehrerer Raubüberfälle zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Trotzdem erteilen ihm die Behörden die Bewilligung, seinen Therapeuten zu besuchen – allein, ohne Begleitung. Eine katastrophale Fehleinschätzung. Das ganze Land fragt sich nach dem Mord an der Pfadfinderin: Wie bloss kann die Justiz einen gefährlichen Straftäter unbegleitet in den Hafturlaub schicken?
Der damalige Zürcher Justizdirektor und spätere Bundesrat Moritz Leuenberger hält in einer Erklärung fest: «Dieser Urlaub ist eine Mitursache des Verbrechens. Diese Mitursache hat der Staat gesetzt und zu verantworten.» Die Tat führt zu tiefgreifenden Reformen im Justizwesen und zu einem deutlich restriktiveren Umgang mit inhaftierten Gewalt- und Sexualtätern. Das Versprechen: Niemals soll so etwas wieder passieren.
Jérôme Endrass, stellvertretender Leiter von Justizvollzug und Wiedereingliederung und forensischer Psychologe, sagt, Nullrisiko sei eine Illusion. «Rückfälle wird es immer geben. Man kann nicht bei allen Tätern alles wegtherapieren und die Risikofaktoren so ausmerzen, dass sie keine Gefahr mehr darstellen für die Gesellschaft.»
Hat ein Gefangener zwei Drittel seiner Strafe abgesessen, müssen die Behörden prüfen, ob er bedingt, unter Ansetzung einer Probezeit, entlassen werden kann. Die Anforderungen dafür sind das Verhalten im Strafvollzug und eine günstige Prognose. Das Amt stützt sich für seinen Entscheid auf einen Bericht der Anstaltsleitung und hört den Gefangenen an. Kommt es zum Schluss, dass der Inhaftierte weitere Verbrechen begehen könnte, muss er die volle Strafe absitzen. Danach muss der Gefangene entlassen werden – auch wenn die Gefängnisleitung kein gutes Gefühl dabei hat.
Untersuchungen haben ergeben, dass sich die Zahl der Rückfälle, gerade bei schweren Straftaten, in den letzten 15 bis 20 Jahren fast halbiert hat. Möglicherweise seien die Wiedereingliederungsprogramme für Straftäter besser geworden, sagt Jérôme Endrass. «Genau wissen wir es aber nicht.»
Laut Endrass wurde noch vor zehn Jahren einer von sieben inhaftierten Gewaltstraftätern der JVA Pöschwies rückfällig. Vermutlich sei die Rückfallquote inzwischen tiefer, sagt er. Alle Zahlen zur Rückfallquote müssen aber mit Vorsicht interpretiert werden, weil viele der Ausländer nach Absitzen ihrer Strafe des Landes verwiesen werden. Wie viele von ihnen erneut delinquieren, bleibt deshalb im Dunkeln.
Der Sexualstraftäter
Das Sicherheitsdenken bekommen Straftäter wie Peter Egli (Name geändert) zu spüren. Egli, um die 40 Jahre alt, Schweizer, sitzt seit fünfeinhalb Jahren in der Forensisch-Psychiatrischen Abteilung der JVA Pöschwies. Er wurde wegen eines Sexualdelikts zu einer stationären Massnahme verurteilt. Das bedeutet, er muss eine Therapie absolvieren. «Kleine Verwahrung» wird die Massnahme nach Artikel 59 im Strafgesetzbuch im Volksmund auch genannt.
Wann er die Pöschwies wieder verlassen kann, weiss Egli nicht. Zwar beträgt die Höchstdauer einer stationären Massnahme in der Regel fünf Jahre, sie kann aber gerichtlich auf Antrag der Bewährungs- und Vollzugsdienste verlängert werden, um maximal fünf Jahre – und das immer wieder. Bei Egli ist das zuständige Gericht bei der ersten Überprüfung zum Schluss gekommen, dass er noch nicht bereit ist für die Freiheit. Es hat die Massnahme verlängert.
Egli ist frustriert. Das Warten und die Ungewissheit nagten an ihm, sagt er. Er selbst glaubt, das Rüstzeug für ein Leben in Freiheit zusammenzuhaben. Der Gefängnisalltag schlage ihm aufs Gemüt, er könne schlecht abschalten. Ausser in der Zelle gebe es kaum Privatsphäre. Wenn er im Aufenthaltsraum sitze und hinter ihm aus der Zelle eines Mitgefangenen Musik ertöne, ärgere ihn das. «Viele Leute nehmen keine Rücksicht.»
Zu seinem Delikt möchte er sich gegenüber den Journalisten nicht genauer äussern. Er sagt bloss: «Ich habe es nie abgestritten. Ich weiss, dass ich einen Fehler gemacht habe.» Dass er deswegen ins Gefängnis musste, hat er akzeptiert. «Die Strafe ist ein Kapitel, das nicht hätte sein müssen und doch sein musste.» Was er damit meint: In den Therapien habe er gelernt, sich mit seiner Tat auseinanderzusetzen – obwohl er sich anfangs dagegen gesträubt habe. Er habe nicht eingesehen, warum er vor fremden Menschen sein Innerstes nach aussen kehren müsse. «Ich habe meine Probleme in mich hineingefressen.»
Mit der Zeit habe er aber gelernt, sich zu öffnen. Inzwischen vertraue er den Therapeuten. «Sie wissen mehr über mich als alle Menschen in meinem Umfeld. Ich wüsste nicht, was ich vor ihnen verheimlichen sollte.» Egli glaubt: «Die meisten von uns sind willens, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren.»
Ein wichtiges Element auf seinem Weg zurück in die Freiheit sind die Hafturlaube, die bisher immer in Begleitung eines Gefängnis-Mitarbeitenden stattfanden. Sie sind keine Vollzugslockerung, sondern müssen einen therapeutischen Zweck haben. Egli hat genau notiert, wie oft er schon draussen war. 10 Mal in der Gruppe mit anderen Insassen. 34 Mal zu zweit. Meistens besucht er die Familie. Sie ist der letzte Kontakt in der Freiheit, der noch zu ihm hält. Viele Bekanntschaften sind verlorengegangen. Egli sagt: «Die meisten meiner Freunde haben sich von mir abgewandt.»
Sinkt die Rückfallgefahr, je länger ein Sexualstraftäter wie Egli im Gefängnis bleibt und therapiert wird? Oder wird sie im Gegenteil erhöht, weil das Leben draussen immer weiter in die Ferne rückt?
Der Betreuer
Einige der Straftäter in der Pöschwies verbringen einen grossen Teil des Erwachsenenlebens hinter Gitter. Jeden Tag die gleichen Gesichter, die gleiche Umgebung, die gleiche, oft monotone Arbeit und kaum soziale Kontakte. Alles wird den Gefangenen abgenommen: Kochen, Wäschewaschen, Putzen. Und draussen zieht das Leben vorbei. Wer die letzten zehn Jahre im Gefängnis verbrachte, hat den Shutdown während der Corona-Pandemie und Trumps Präsidentschaft verpasst, vermutlich noch nie einen Tesla gesehen oder Twint benutzt.
Hans-Ueli Gantenbein hat die Aufgabe, Straftäter auf die nahende Freiheit vorzubereiten. Seit fast 33 Jahren kümmert er sich in der Pöschwies um die Betreuung von Straftätern. Er hat sie alle kennengelernt – die psychisch kranken Langzeithäftlinge, die Verwahrten, die Sexualstraftäter, die Mörder, die Pädophilen und Anfang der neunziger Jahre die kleinkriminellen Heroinsüchtigen.
Hunderte von ihnen hat der 59-Jährige auf dem ersten Freigang aus dem Gefängnis begleitet, Hunderte hat er auf das Leben nach der Freilassung vorbereitet. Und er hat eingegriffen, wenn einer aufbegehrte oder sich nicht an die Regeln im Gefängnis hielt. Bei dieser Aufgabe müsse man die Menschen mögen, sagt Gantenbein. «Mit Misstrauen würde es niemals funktionieren. Denn wenn die Häftlinge mich nicht spüren, dann findet keine Beziehung statt.»
Den ersten Freigang beginnt Gantenbein immer mit einem Ritual. Er trifft den Insassen vor der Pöschwies und ruft ihm zu: «Willkommen draussen.» Dann spazieren sie rund um den Katzensee. Gantenbein sagt: «Es ist für die Insassen wie ein Ausbruch aus dem Alltag. Ich trage keine Uniform, er trägt keine Anstaltskleider.»
Im Gefängnis fehlten irgendwann neue Reize, der Urlaub sei da, um das Leben zurückzuholen. Dass sich jemand hinter Gittern anständig verhalte, bedeute noch nicht, dass er es auch in Freiheit könne. «Die Entscheidung, deliktfrei zu leben, muss jeder selbst fällen.» Gantenbein, rundes Gesicht, Schnurrbart und sanfte Stimme, hat die Freuden der Insassen erlebt, aber auch die grossen Dramen. Viele Häftlinge, sagt er, hätten Angst vor der Rückkehr in die Freiheit.
Er erzählt von einem dieser Dramen. Er begleitet an jenem Tag einen Häftling auf seinem Freigang. Zuerst ist ein Essen mit der Mutter des Mannes geplant. Die beiden, das weiss der Betreuer, hatten ein schwieriges Verhältnis. Die Frau prostituierte sich, war kaum für den Sohn da. Gantenbein und der Mann fahren mit dem Zug nach Oerlikon. Dort wartet in einem Schnellimbiss die Mutter. Sie setzen sich an einen Tisch, Gantenbein hört zu, versteht aber nichts, weil sich die Frau in ihrer Muttersprache mit dem Sohn unterhält. Plötzlich steht der junge Mann auf und teilt ihm mit, sie müssten jetzt gehen.
Als sie wieder im Zug sitzen, fragt Gantenbein: «Was war da los?» Der Mann erzählt ihm eine vollkommen verstörende Geschichte. Seine Mutter habe ihm gedroht, dass sie sich aus dem Fenster in den Tod stürze, wenn er nicht zu ihr komme und mit ihr Sex habe.
Erschüttert reisen Gantenbein und der Häftling weiter. Geplant ist ein Besuch bei der Grossmutter im Alterszentrum. Doch als sie zu der alten Dame geführt werden, folgt der nächste Schock: Die Frau, an Demenz erkrankt, erkennt ihren Enkel nicht mehr. «Das war der zweite Tiefschlag an diesem Tag.»
Gantenbein beschliesst, mit dem Mann an den See zu fahren – was im Programm nicht vorgesehen war. Dort sei der Häftling ins Wasser gesprungen und habe losgeheult. «Er hat sich buchstäblich den Dreck abgewaschen.»
Die Kritikerin
Die Debatte über den schweizerischen Strafvollzug entzündet sich immer wieder an der gleichen Frage: Ist er zu stark auf die Bedürfnisse der Täter und zu wenig auf die Sicherheit der Bevölkerung ausgerichtet? Der Pöschwies-Direktor Naegeli ist überzeugt, dass die Chancen auf Resozialisierung besser stehen, wenn Gefangene sich in Eigenverantwortung und Selbstbestimmung üben können. Künftig sollen sie deshalb innerhalb der Anstalt mehr Zugang zu Aussenräumen erhalten, ihre Freizeit sinnvoll gestalten können und Arbeiten wie Wäschewaschen selbst übernehmen. Auch das Besuchsrecht soll erweitert werden.
Es gibt aber auch Kreise, die dieser Entwicklung kritisch gegenüberstehen. Zu ihnen gehört SVP-Kantonsrätin Nina Fehr Düsel. Sie sagt: «In manchen Gefängnissen wird bereits heute fast nur auf die Resozialisierung gesetzt. Da verschwindet die abschreckende Wirkung, die eine Freiheitsstrafe haben sollte.» Wohngruppen für Verwahrte etwa, wie sie in einigen Kantonen vorgeschlagen werden, lehnt sie aufgrund der hohen Kosten ab.
Fehr Düsel ist Juristin und Mitglied der Justizkommission. Sie betont, dass sie das System des Schweizer Strafvollzugs grundsätzlich gut finde. Gerade bei Jugendlichen sei der Resozialisierungsgedanke wichtig, «schliesslich haben sie das Leben noch vor sich». Doch für sie stehen die Opfer im Vordergrund, nicht die Täter. «Und ich habe den Eindruck, dass die Opfer im System manchmal vergessengehen.»
Sie verweist auf Fälle in der Vergangenheit, bei denen aus ihrer Sicht der Schutz der Bevölkerung missachtet wurde. So wie im Fall von Tobias K. Am 23. Juni 2016 tritt Tobias K. seinen ersten unbegleiteten Hafturlaub an, eineinhalb Jahre müsste er da bei guter Führung noch absitzen. Doch statt zurück in die Pöschwies zu gehen, taucht er unter – und tötet eine Woche später einen Mann im Zürcher Seefeld, ein Zufallsopfer.
Die Justiz gerät in Erklärungsnot. Über die Fahndung nach dem flüchtigen Straftäter informieren die Behörden erst neun Tage nach seinem Verschwinden. In einem Radiointerview meldet sich auch die Mutter der ermordeten Pfadfinderin zu Wort. «Der Mann hätte nicht sterben müssen», sagt sie im Radio Energy. Die Justiz sei allerdings an einem anderen Punkt als noch beim Mord an ihrer Tochter. «Der Kampf hat sich gelohnt. Besonders bei schweren Tätern schaut man heute genauer hin.»
Fälle wie Tobias K. sind selten. Ganz ausschliessen lassen sie sich nicht in einem System, das einen anderen Weg geht als den von maximaler Repression und Kontrolle. Und ein Szenario, bei dem gefährliche Straftäter statt hinter Gefängnismauern in gesicherten Wohnsiedlungen oder wie in Norwegen auf Inseln untergebracht sind, wäre in der Schweiz kaum denkbar: zu wenig Platz, zu teuer. So gesehen, ist das hiesige System vielleicht das am wenigsten schlechte.
Der Rückkehrer
Und so setzt das Land auf das Prinzip der kleinen Schritte: Je näher die Entlassung eines Häftlings rückt, desto mehr Freiheiten werden ihm gewährt, um ihn langsam auf das Leben ausserhalb der Gefängnismauern vorzubereiten. Wie beim Gewalttäter Luan Elezi. Der Dreissigjährige wird im Mai zwei Drittel seiner Freiheitsstrafe verbüsst haben. Dann wird er bedingt aus der Justizvollzugsanstalt Pöschwies entlassen, wenn alles gutgeht.
Eine 48-monatige Freiheitsstrafe und eine ambulante Therapie hatte Elezi aufgebrummt bekommen. Die Tat liegt sechs Jahre zurück. 2017 passiert es, in einer dieser Nächte an der Zürcher Langstrasse, in denen zu viel Alkohol, zu viele Drogen und zu viel Testosteron zusammenkommen. Aus Worten werden Drohungen, aus Drohungen Schläge, aus dem Partygänger Elezi ein Straftäter.
Er sagt: «Ich wurde angegriffen, habe mich verteidigt. Aber das Gesetz ist blind. Es interessiert keinen, ob der andere dich zuvor provoziert hat. Wenn seine Verletzungen gröber sind als deine, dann bist du der Täter. Das musste ich im Gefängnis lernen und akzeptieren.»
Die Freiheitsstrafe ändert vieles: Elezi und seine Freundin geben die gemeinsame Wohnung auf, sie zieht zurück zu ihren Eltern, er ins Gefängnis. «Ich hatte zwei Autos, mir ging es gut. Das alles zu verlieren, war mega scheisse.» Doch zu seinem Glück kommt Elezi direkt in den offenen Vollzug. Dort gibt es keine Mauern, keine Sicherheitskontrollen und keine verschlossenen Türen in den Gängen. Die Gefangenen sollen sich an den Alltag in Freiheit herantasten können.
Zuerst bekommt Elezi Arbeiten im Gefängnis zugeteilt – in der Gärtnerei, im Hausdienst. Seit kurzem hat er einen Job draussen, bei einer Sägerei. Bekommen hat er ihn über die Arbeitsvermittlung der Pöschwies. Die Stelle bei der Sägerei will Elezi auch nach der Freilassung behalten. Es sei zwar nicht sein Traumjob, aber er löse seine Probleme. Denn Elezi schuldet noch Geld – mehrere zehntausend Franken. Es sind Kosten für den Anwalt, die Entschädigung für das Opfer.
Nun hat er mit der Planung der Zukunft begonnen. «Ich habe es ausgerechnet. In zehn Jahren werden ich und meine Freundin die Anzahlung für eine Eigentumswohnung beisammenhaben.» Diesen Traum will er sich erfüllen. «Aber nicht mit kriminellen Sachen, das ist vorbei.» Dann wäre er einer von denen, die im Gefängnis zum besseren Menschen geworden sind.